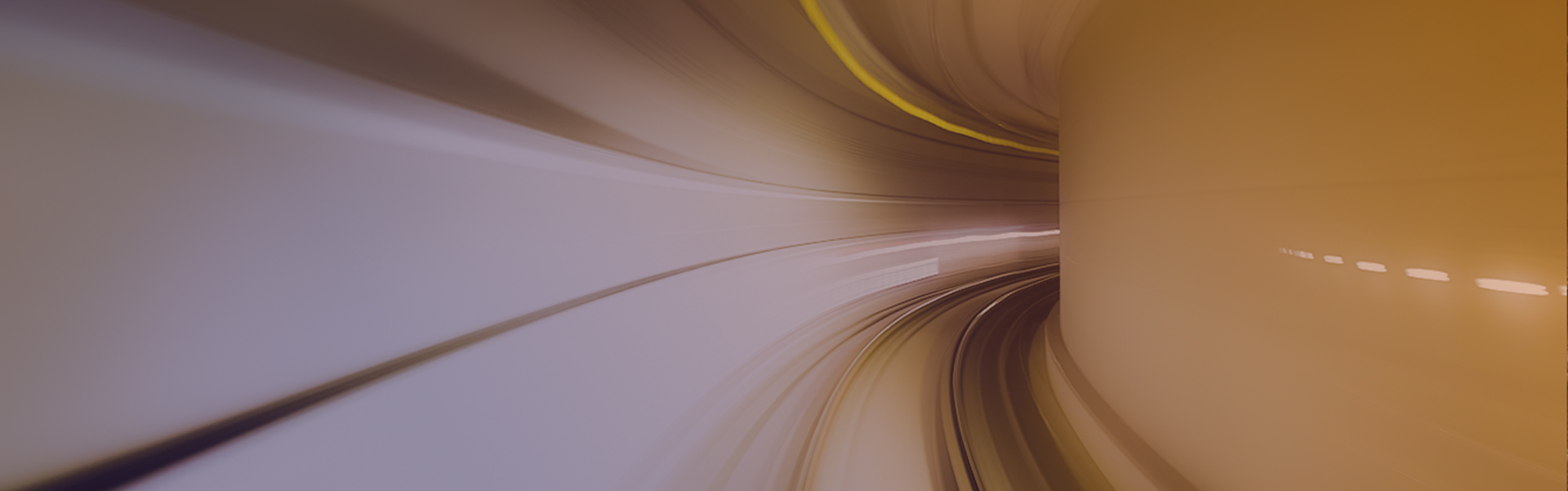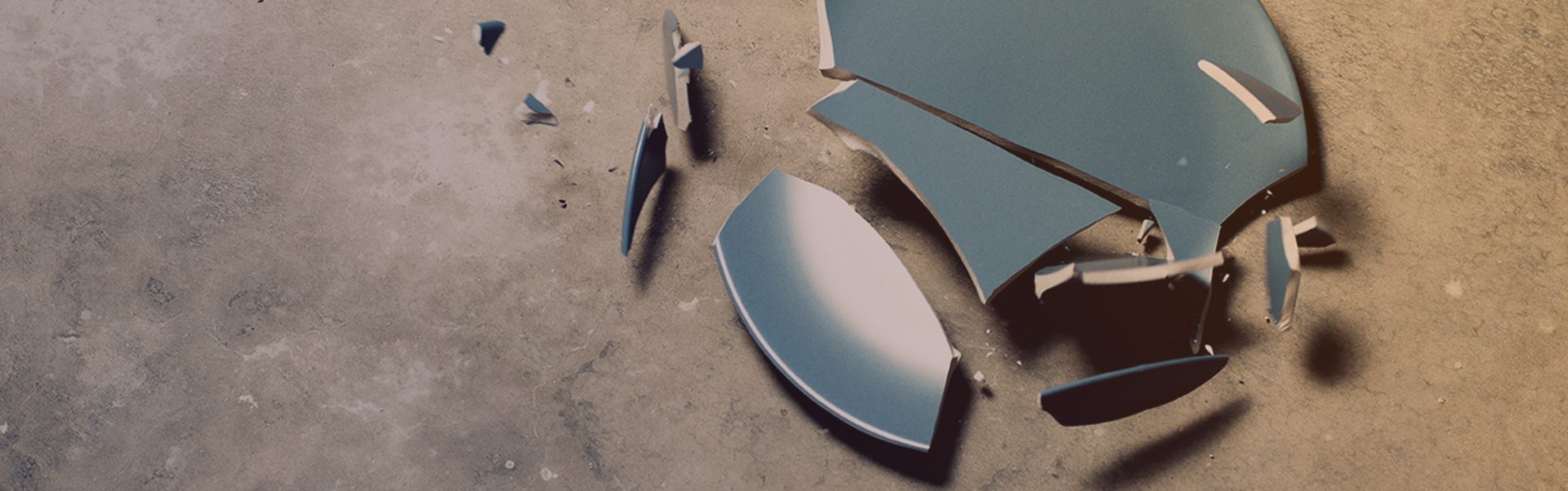- Wie fühlt sich eine Suchterkrankung an?
- Woher kommt eine Suchterkrankung?
- Was passiert bei einer Suchterkranung?
- Hilfe bei einer Suchterkrankung
- Wenn kann ich ansprechen?
Süchte gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, und sie beziehen sich entweder auf ein bestimmtes Mittel oder ein Verhalten. Sie alle haben gemeinsam, dass im Gehirn starke Glücks- und Belohnungsgefühle durch dieses Mittel oder Verhalten ausgelöst werden. Der sogenannte Belohnungseffekt verleitet dazu, die Sucht erneut zu befriedigen, also das Mittel erneut einzunehmen oder das Verhalten zu wiederholen. Der Wunsch nach Belohnung durch diese Sucht ist besonders dann groß, wenn es der betroffenen Person gerade nicht gut geht – zum Beispiel, wenn sie Sorgen oder Ängste hat. Viele Betroffene haben das Gefühl, die Kontrolle über die Sucht zu verlieren. Das heißt, sie können ihr Verhalten in Bezug auf ihre Sucht nicht mehr steuern, und sie wird für sie zu einer Art Zwang.
Folgende Beschwerden können auf eine Abhängigkeit hinweisen – besonders, wenn sie ständig da sind:
- ein sehr starker Wunsch danach, Alkohol, Tabletten oder andere Drogen einzunehmen – auch wenn dieses Verhalten schädlich ist
- dieser Wunsch kann sich auch auf ein bestimmtes Verhalten beziehen, wie Glücksspiel, Online-Shopping oder Computerspielen
- keine Kontrolle mehr darüber, ob und wieviel Alkohol, Tabletten oder andere Drogen eingenommen werden oder wann sie eingenommen werden
- es muss immer mehr konsumiert werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen
- körperliche Beschwerden wie Unruhe, Zittern oder Schmerzen, wenn die Sucht nicht befriedigt werden kann
- die Gedanken kreisen ständig um die Sucht und es fällt sehr schwer, sich auf etwas Anderes zu konzentrieren
- kein Interesse mehr an Dingen, die einem vorher Freude bereitet haben, wie Freundschaften oder Hobbies
- Heimlichkeiten in Bezug auf den Konsum oder das Verhalten
Der andauernde Zustand in einer Sucht hat schädliche Folgen – aber Personen, die an einer Sucht erkrankt sind, können ihr Verhalten nicht steuern, obwohl ihnen diese Folgen bewusst sind.
Was ist ein Suchtmittel?
Ein Suchtmittel ist ein Stoff, der mit hoher Wahrscheinlichkeit abhängig macht. Es gibt legale Suchtmittel wie Alkohol, Medikamente oder Zigaretten, und illegale Suchtmittel wie Cannabis, Speed, Kokain, Ecstasy oder Heroin. Suchtmittel unterscheiden sich außerdem in ihrer Wirkung und darin, wie schädlich sie sind und wie schnell sie abhängig machen.
Was sind Verhaltenssüchte?
Verhaltenssüchte beziehen sich auf ein bestimmtes Verhalten, das nicht mehr kontrolliert werden kann und so viel Raum im Leben der Betroffenen einnimmt, dass es ihnen sehr schadet. Wie bei den Suchtmitteln gibt es auch bestimmte Verhaltensweisen, die eher süchtig machen als andere. Glücksspielsucht und Internetsucht sind weit verbreitete Verhaltenssüchte, ebenso wie Kaufsucht, Sexsucht oder Arbeitssucht. Sie alle haben gemeinsam, dass das Verhalten starke Glücks- und Belohnungsgefühle im Gehirn auslöst – zum Beispiel, wenn man sich etwas Schönes gekauft hat oder am Spielautomaten Geld gewonnen hat. Das ruft bei den Betroffenen den Drang hervor, dieses Verhalten immer öfter zu wiederholen. Dass wir Dinge tun, die uns ein gutes Gefühl geben, ist grundsätzlich toll. Bei einer Verhaltenssucht wird dieses Wiederholen aber zu einer Art Zwang.
Ein paar Beispiele:
Süchte gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, und sie beziehen sich entweder auf ein bestimmtes Mittel oder ein Verhalten. Sie alle haben gemeinsam, dass im Gehirn starke Glücks- und Belohnungsgefühle durch dieses Mittel oder Verhalten ausgelöst werden. Der sogenannte Belohnungseffekt verleitet dazu, die Sucht erneut zu befriedigen, also das Mittel erneut einzunehmen oder das Verhalten zu wiederholen. Der Wunsch nach Belohnung durch diese Sucht ist besonders dann groß, wenn es der betroffenen Person gerade nicht gut geht – zum Beispiel, wenn sie Sorgen oder Ängste hat. Viele Betroffene haben das Gefühl, die Kontrolle über die Sucht zu verlieren. Das heißt, sie können ihr Verhalten in Bezug auf ihre Sucht nicht mehr steuern, und sie wird für sie zu einer Art Zwang.
Folgende Beschwerden können auf eine Abhängigkeit hinweisen – besonders, wenn sie ständig da sind:
- ein sehr starker Wunsch danach, Alkohol, Tabletten oder andere Drogen einzunehmen – auch wenn dieses Verhalten schädlich ist
- dieser Wunsch kann sich auch auf ein bestimmtes Verhalten beziehen, wie Glücksspiel, Online-Shopping oder Computerspielen
- keine Kontrolle mehr darüber, ob und wieviel Alkohol, Tabletten oder andere Drogen eingenommen werden oder wann sie eingenommen werden
- es muss immer mehr konsumiert werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen
- körperliche Beschwerden wie Unruhe, Zittern oder Schmerzen, wenn die Sucht nicht befriedigt werden kann
- die Gedanken kreisen ständig um die Sucht und es fällt sehr schwer, sich auf etwas Anderes zu konzentrieren
- kein Interesse mehr an Dingen, die einem vorher Freude bereitet haben, wie Freundschaften oder Hobbies
- Heimlichkeiten in Bezug auf den Konsum oder das Verhalten
Der andauernde Zustand in einer Sucht hat schädliche Folgen – aber Personen, die an einer Sucht erkrankt sind, können ihr Verhalten nicht steuern, obwohl ihnen diese Folgen bewusst sind.
Was ist ein Suchtmittel?
Ein Suchtmittel ist ein Stoff, der mit hoher Wahrscheinlichkeit abhängig macht. Es gibt legale Suchtmittel wie Alkohol, Medikamente oder Zigaretten, und illegale Suchtmittel wie Cannabis, Speed, Kokain, Ecstasy oder Heroin. Suchtmittel unterscheiden sich außerdem in ihrer Wirkung und darin, wie schädlich sie sind und wie schnell sie abhängig machen.
Was sind Verhaltenssüchte?
Verhaltenssüchte beziehen sich auf ein bestimmtes Verhalten, das nicht mehr kontrolliert werden kann und so viel Raum im Leben der Betroffenen einnimmt, dass es ihnen sehr schadet. Wie bei den Suchtmitteln gibt es auch bestimmte Verhaltensweisen, die eher süchtig machen als andere. Glücksspielsucht und Internetsucht sind weit verbreitete Verhaltenssüchte, ebenso wie Kaufsucht, Sexsucht oder Arbeitssucht. Sie alle haben gemeinsam, dass das Verhalten starke Glücks- und Belohnungsgefühle im Gehirn auslöst – zum Beispiel, wenn man sich etwas Schönes gekauft hat oder am Spielautomaten Geld gewonnen hat. Das ruft bei den Betroffenen den Drang hervor, dieses Verhalten immer öfter zu wiederholen. Dass wir Dinge tun, die uns ein gutes Gefühl geben, ist grundsätzlich toll. Bei einer Verhaltenssucht wird dieses Wiederholen aber zu einer Art Zwang.
Ein paar Beispiele:
Glücksspielsucht ist eine Krankheit, bei der die Betroffenen hohe Mengen an Geld verspielen – an Automaten in Spielotheken, in Online-Casinos, bei Online-Wetten oder in Wettbüros. Erst machen diese Spiele Spaß und lösen Glücksgefühle aus, aber dann wird der Weg in die Spielothek schnell zum Zwang: Betroffene werden unruhig und reizbar, wenn sie nicht spielen können. Sie spielen mit immer höheren Einsätzen, um Verluste auszugleichen, und spielen auch dann weiter, wenn sie ihr gesetztes Limit erreicht haben. Das hat sehr oft vor allem finanzielle Folgen im Leben der Betroffenen: Sie haben kein Geld mehr für Rechnungen, Reparaturen im Haushalt, für Essen, Strom oder die Miete. Oft verschulden Betroffene sich im Freundes- und Bekanntenkreis oder nehmen teure Kredite auf, um weiter spielen zu können. Gleichzeitig verlieren sie Beziehungen zu Menschen, die ihnen wichtig sind. Das kann daran liegen, dass die Betroffenen das Vertrauen der Menschen in ihrem Umfeld verlieren, oder auch daran, dass sie sich selbst aus ihrem gewohnten Umfeld zurück ziehen.
Wichtige Anzeichen für eine Spielsucht sind:
Starkes Verlangen: Bei Spielsüchtigen wird das Spielen zum wichtigsten Lebensinhalt. Das Denken und Handeln kreist immer mehr um die Fragen: „Wann kann ich wieder spielen? Ist genug Geld da, um Spielen zu können?“.
Kontrollverlust: Spielsüchtige können ihr Verhalten in Bezug auf das Spielen nicht mehr steuern. Sie spielen einfach weiter, solange es geht – auch bei großen Verlusten oder bis kein Geld mehr da ist. Das macht eine Spielsucht so gefährlich, denn daraus können hohe Verschuldungen entstehen.
Toleranzentwicklung: Bei vielen Spielsüchtigen stehen am Anfang große Gewinne, die einen großen Reiz ausüben und das Gefühl vermitteln, dass es immer so weiter geht. Das Gegenteil ist aber der Fall: Das Glück lässt schnell nach, und um verlorene Summen wieder zu bekommen, muss man weiter spielen. Das Glücksgefühl vom Anfang kommt erst dann wieder hoch, wenn höhere Summen gewonnen werden – schließlich müssen die Verluste wieder eingeholt werden.
Entzugssymptome: Wie bei anderen Süchten auch fühlen sich Spielsüchtige nervös, unruhig oder gereizt, wenn sie nicht spielen können.
Vernachlässigen von Freundschaften und Hobbies: Der Spieldruck führt dazu, dass Betroffene viel Zeit in Spielotheken oder mit dem Spielen verbringen. Auch die Geldbeschaffung, zum Beispiel durch den Verkauf von Einrichtungsgegenständen, nimmt zunehmend Zeit in Anspruch. Freundschaften und Hobbies geraten in den Hintergrund, auch, weil niemand etwas von dem schädlichen Verhalten mitbekommen soll.
Weiterspielen trotz schädlicher Folgen: Süchtige nehmen die schädlichen Folgen ihres Verhaltens oft sehr lange in Kauf. Der Drang zu spielen ist so stark, das auch hohe Verschuldungen, der Verlust von Freundschaften oder Probleme im Beruf daran nichts ändern.
Folgende Fragen können dir helfen zu erkennen, ob du bereits auf dem Weg zu einer Spielsucht bist:
- Verspielst du mehr Geld, als du eigentlich möchtest?
- Musst du auf andere wichtige Dinge – wie Essen, Kleidung oder Hobbies – verzichten, weil du dein Geld beim Spielen verlierst?
- Verschuldest du dich bei deiner Familie, Freundinnen oder Freunden, um weiter spielen zu können?
- Ist es dir unangenehm, darüber zu reden, wie viel oder wie oft du spielst?
Wenn du das Gefühl hast, von einer Spielsucht gefährdet zu sein, solltest du dir Hilfe und Unterstützung holen. Freundinnen, Freunde und die Familie können eine große Unterstützung sein, aber wenn du dich erstmal anonym austauschen oder professionelle Hilfe bekommen möchtest, gibt es viele Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat hier einige aufgelistet und bietet auch eine Telefonhotline an.
Neben Tabak- ist die Alkoholsucht die in Deutschland am weitesten verbreitete Suchterkrankung. Es gibt unterschiedliche Formen und Entwicklungsstufen der Alkoholsucht. Medizinisch wird zwischen Alkohol-Missbrauch und Alkohol-Abhängigkeit unterschieden, wobei die Übergänge fließend sind.
Von Alkoholmissbrauch spricht man dann, wenn der Alkohol bereits eine Funktion im Leben der Betroffenen übernimmt, wie sich zu entspannen oder sich zu belohnen. Wird diese Funktion für längere Zeit regelmäßig benutzt, kann es zur Abhängigkeit kommen. Dieser Prozess passiert oft unbemerkt, sodass weder die betroffene Person noch ihre Freundinnen, Freunde oder die Familie den Beginn einer Alkoholsucht bemerken. Deswegen ist es wichtig, auf sich und nahestehende Personen zu achten und erste Anzeichen ernst zu nehmen.
Wichtige Anzeichen für eine Alkoholsucht sind:
Starkes Verlangen: Sehr charakteristisch ist ein starkes Verlangen nach Alkohol. Das Verlangen wird umso stärker, je mehr die Betroffenen versuchen, nicht zu trinken. Frag dich selbst: Suchst du dir zunehmend Gelegenheiten, um Alkohol zu trinken?
Kontrollverlust: Betroffene haben keine Kontrolle mehr über ihr Trinkverhalten oder die Menge ihres Konsums. Während gesunde Menschen nach einem Glas wieder aufhören können, ist es bei Alkoholsüchtigen so, als würde ein Schalter in ihrem Kopf umgelegt werden, der dazu führt, dass sie immer weiter trinken, auch wenn sie beispielsweise am nächsten Tag früh aufstehen müssen oder einen wichtigen Termin haben.
Toleranzentwicklung: Betroffene müssen immer mehr Alkohol trinken, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das liegt daran, dass ihr Körper sich bereits an die Mengen gewöhnt hat. Menschen mit Suchterkrankung vertragen dann oft sehr viel mehr als nicht süchtige Menschen.
Entzugssymptome: Entzugssymptome wie Zittern, Schwitzen, Schlafstörungen, Angst und depressive Verstimmungen weisen bereits sehr stark auf eine Abhängigkeit hin. Sie zeigen an, dass Körper und Geist ohne den Alkohol nicht mehr richtig funktionieren, und verschwinden in der Regel, wenn wieder neuer Alkohol getrunken wird.
Vernachlässigen von Freundschaften und Hobbies: Da der Alkohol einen sehr großen Platz im Leben der Betroffenen einnimmt, rücken andere Interessen und auch Freundinnen, Freunde oder die Familie immer weiter in den Hintergrund. Auch Heimlichkeiten spielen hierbei eine große Rolle, denn viele Betroffene ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück, damit niemand merkt, wie viel oder wie oft sie trinken.
Andauernder Konsum trotz schädlicher Folgen: Wer süchtig ist, nimmt die schädlichen Folgen seines Trinkens in Kauf. Das können körperliche Beschwerden sein – wie der Kater am nächsten Tag -, aber auch das Verpassen wichtiger Termine, schlechte Leistungen bei der Arbeit oder Probleme mit Freundinnen, Freunden und in der Familie aufgrund des Alkoholkonsums. Auf lange Sicht kann eine Alkoholsucht gravierende körperliche Folgen haben, zum Beispiel Erkrankungen der Leber, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse oder der Magenschleimhaut.
Folgende Fragen können dir helfen zu erkennen, ob dein Umgang mit Alkohol bereits ungesund ist:
- Trinkst du mehr, als du dir eigentlich vorgenommen hast?
- Wirst du unruhig bei dem Gedanken, nicht trinken zu können?
- Hast du manchmal Gedächtnislücken, weil du zu viel getrunken hast?
Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortest, solltest du dir Hilfe holen und mit jemanden darüber sprechen. In frühen Stadien ist es noch einfacher, eine Suchterkrankung wieder in den Griff zu bekommen. Vertraue dich einem Familienmitglied, einer Freundin oder einem Freund an. Wenn du lieber mit jemandem sprechen möchtest, den du nicht kennst, kannst du jederzeit kostenlos und anonym die Telefonseelsorge anrufen, und auch das Deutsche Rote Kreuz nennt hier viele Kontaktmöglichkeiten für Unterstützung bei Suchterkrankungen. Wichtig ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist und dich jemandem anvertraust.
Wir leben im digitalen Zeitalter, sind ständig online, posten, streamen, liken, spielen. Bei manchen wird die digitale Welt aber zur Sucht: Sie verlieren die Kontrolle darüber, wie viel Zeit sie in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram verbringen oder wie viel Platz im Alltag die Beschäftigung mit dem Computer oder Handy einnimmt. Auch hier wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert: Wenn andere einen Post liken, teilen oder kommentieren, oder wenn wir erfolgreich in einem Computerspiel sind, schüttet unser Gehirn Glücksgefühle aus. Das weckt den Drang, das Verhalten zu wiederholen oder noch zu steigern, bis wir mehr in der digitalen als in der realen Welt leben. Problematisch wird es dann, wenn unsere Online-Aktivitäten für uns zum Ersatz für das richtige Leben werden, wenn wir wichtige Bedürfnisse – wie Anerkennung zu erfahren oder beliebt und erfolgreich zu sein – nur online ausleben oder negative Gefühle in der echten Welt dadurch verdrängen.
Wichtige Anzeichen für eine Internetsucht sind:
Ständiges Verlangen: Wer online-süchtig ist, verspürt ständig den Drang, online zu sein und seine Netzwerke auf neue Nachrichten zu prüfen. Betroffene checken ihre Apps und Messenger mehrmals stündlich und sogar dann, wenn schon klar ist, dass keine neuen Nachrichten eingegangen sind.
Kontrollverlust: Betroffene verlieren die Kontrolle darüber, wie oft und wie lange sie online sind oder am Computer spielen. Aus einer Stunde kann schnell eine Nacht werden. Sie werden unruhig bei dem Gedanken, keinen Zugang zu ihrem Handy, Computer oder sozialen Netzwerken haben.
Toleranzentwicklung: Damit die Sucht befriedigt wird, muss auch bei der Computersucht oft immer mehr konsumiert werden. Das kann bedeuten, dass die Sucht immer mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber auch, dass die Ausprägung immer stärker wird – Spiele werden wichtiger als andere Dinge, die Frustration bei nicht ausreichenden Reaktionen auf einen Post wird größer oder die Aktivitäten im Internet werden extremer.
Entzugssymptome: Auch bei Online-Sucht gibt es Entzugssymptome: Dazu gehören insbesondere Unruhe und Gereiztheit, aber auch körperliche Symptome wie Zittern oder Schwitzen.
Vernachlässigen von Freundschaften und Hobbies: Das Spielen am Computer oder die Aktivitäten in sozialen Netzwerken nehmen einen sehr großen Platz im Leben der Betroffenen ein. Interessen im echten Leben und auch Freundschaften oder Familie rücken dadurch immer weiter in den Hintergrund. Besonders bei der Computerspielsucht findet ein Rückzug aus dem sozialen Leben statt. Das Tückische an sozialen Netzwerken ist, dass diese immer und überall genutzt werden können, also auch im Beisein von Freundinnen und Freunden.
Aufrechterhalten des Verhaltens trotz schädlicher Folgen: Betroffene merken oft selbst, dass ihre Computersucht negative Folgen auf ihr normales Leben hat, kommen aber trotzdem nicht von selbst aus ihrer Sucht heraus. Vielleicht haben sie auch schon Freundinnen oder Freunde verärgert und wurden von ihnen darauf hingewiesen, dass sie zu viel am Handy oder vor dem Computer hängen. Wie bei anderen Suchterkrankungen auch ist es aber meistens nicht möglich, ohne professionelle Hilfe und die Unterstützung von der Familie oder Freundinnen und Freunden die Sucht in den Griff zu bekommen.
Wenn du dir Sorgen um dein online-Verhalten oder das einer nahestehenden Person machst, kannst du dich an eine der vielen Hilfsangebote wenden – auch anonym, wenn dir das lieber ist. Ob du erstmal mit einer Freundin, einem Freund, oder einem Familienmitglied darüber sprechen möchtest, dein online-Verhalten besser verstehen, oder erstmal selbst versuchen möchtest, weniger online zu sein: Die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung hat hier viele Tipps dafür zusammengestellt, zeigt Anlaufstellen in deiner Nähe und bietet selbst eine Beratung an.
Auch, wenn sich eine Internetsucht vielleicht nicht wie eine „echte“ Sucht anfühlt, hat sie sehr großen Einfluss auf das Leben einer betroffenen Person und auf ihren Freundes- und Familienkreis. Beobachte deswegen deine eigene online-Nutzung und die deiner Freundinnen und Freunde, und zögere nicht, darüber zu sprechen oder Unterstützung zu suchen, wenn dir etwas Sorgen bereitet.
Sucht ist eine Erkrankung im Gehirn, bei der psychische, soziale und biologische Einflüsse zusammenspielen. Oft gibt es Probleme im Leben der Betroffenen, sie kriegen zum Beispiel wenig Halt von der Familie, haben große Sorgen und Ängste um die Zukunft oder müssen den Verlust von geliebten Menschen verarbeiten. Andere psychische Erkrankungen wie Depressionen, eine Borderline-Erkrankung oder Zwangsstörungen können eine Suchterkrankung zusätzlich fördern. Gene und Vererbung spielen ebenfalls eine Rolle: Die Kinder suchtkranker Eltern sind anfälliger dafür, ebenfalls eine Suchterkrankung zu bekommen.
Wie bei jeder psychischen Erkrankung können Betroffene einer Suchterkrankung nichts dafür, dass sie erkrankt sind. Viele Menschen sind der Meinung, dass Menschen mit Suchterkrankungen keine Disziplin hätten oder selbst Schuld an ihrer Erkrankung seien – das stimmt aber nicht! Jede und jeder von uns kann eine Sucht entwickeln, und deswegen ist es wichtig, dass wir anfangen, offen darüber zu sprechen, wenn es uns nicht gut geht, und dass wir aufmerksam und respektvoll auf die Menschen in unserem Umfeld zugehen, um die wir uns Sorgen machen.
Suchterkrankungen sind sehr vielfältig und entstehen individuell. Warum es zum Beginn einer Suchterkrankung kommt, ist also von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Suchterkrankungen basieren aber auf dem gleichen Prozess: Das Gehirn lernt, dass das Suchtmittel oder das Verhalten gut tut, bis sich Betroffene ohne diese nicht mehr gut fühlen können. Es entsteht eine Art Zwang, die Sucht aufrechtzuerhalten.
Die Befriedigung der Sucht löst in der Regel positive Gefühle wie Entspannung, Freude und Ausgelassenheit aus – die Betroffenen fühlen sich gut und stark, alle Probleme verfliegen für eine Weile. Der Körper merkt sich dieses Gefühl und bringt es in einen Zusammenhang mit dem Suchtmittel oder dem süchtig machenden Verhalten. Wenn die Wirkung nachlässt, sind die alten Probleme wieder da. Geht es den Betroffenen schlecht, taucht automatisch der Gedanke an die „befreiende“ Wirkung der Sucht auf. Es fällt ihnen schwer, diesen Gedanken zu ignorieren oder etwas anderes zu finden, was ihnen aus der schlechten Situation helfen kann. Es ist wie ein Zwang für sie, die Sucht zu befriedigen – also zum Beispiel weiter zu trinken oder zu spielen –, weil sie sich nur dadurch wieder gut fühlen können. Das ist der Grund, warum Menschen mit Suchterkrankungen auch dann noch trinken oder spielen, wenn das bereits schlimme Folgen für sie hat. Der Gedanke an ein Leben ohne das Suchtmittel oder das süchtig machende Verhalten macht vielen Betroffenen zunächst Angst. Auch wenn sie selbst den Wunsch haben, nicht mehr süchtig zu sein, ist es sehr schwierig für sie, die ersten Schritte auf diesem Weg zu gehen.
Das Wichtigste ist: Sei ehrlich zu dir selbst. Hast du selbst die Vermutung, dass du die Kontrolle verlierst, du zu viel trinkst, spielst, kiffst oder ähnliches? Oder beobachtest du dieses Verhalten bei einer Freundin, einem Freund oder einem Familienmitglied? Dann sprich mit jemandem darüber! Es gibt viele Anlaufstellen, bei denen professionell ausgebildete Personen dir zuhören und helfen. Die Angebote sind kostenlos und du kannst anonym bleiben. Außerdem bieten viele Kliniken einen Suchtnotruf an, bei dem man jederzeit anrufen kann.
In größeren Städten gibt es auch spezielle Suchtberatungsstellen. Sie bieten viele Informationen zum Hilfsangebot in deiner Stadt, helfen dir dabei, Anträge zu stellen, die richtige Klinik zu finden oder hören erstmal einfach nur zu und beraten dich.
Das Suchthilfe-Netzwerk in Deutschland ist sehr gut ausgebaut und bietet viele Hilfsmöglichkeiten für Betroffene. Grundsätzlich empfiehlt sich der Schritt in eine Therapie. Diese kann ambulant, teilstationär oder stationär erfolgen. Wenn du mehr über das Thema Therapie erfahren möchtest, haben wir hier alles wichtige für dich zusammengefasst.
Suchterkrankungen sind alleine schwer zu bewältigen. Deshalb ist es wichtig, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und über die eigenen Probleme und Erfahrungen zu sprechen. Selbsthilfegruppen bieten dabei eine große Unterstützung, denn hier finden Betroffene Verständnis für ihre Situation und können durch die Erfahrungen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, mit der Suchterkrankung umzugehen. Auch für Angehörige von Menschen, die eine Suchterkrankung haben, gibt es Selbsthilfegruppen.
Du hast dich entschlossen, für dich selbst oder einen nahestehenden Menschen Hilfe zu suchen und fragst dich, wo du Unterstützung finden kannst. Vorab: Du solltest wissen, dass es viele unterschiedliche Anlaufstellen gibt und verschiedene Fachleute in Frage kommen. Wichtig ist es also, zuerst herauszufinden, welcher Weg der passende ist.
Eine gute erste Ansprechperson ist deswegen immer die Hausärztin oder der Hausarzt. Übrigens ist bei denen alles, was mit ihnen besprochen wird, gut aufgehoben: Sie dürfen und werden wegen der ärztlichen Schweigepflicht mit niemandem darüber reden, was man ihnen erzählt. Natürlich kann ein Familienmitglied, eine Freundin oder ein Freund mit zum Gespräch kommen.
Es ist auch möglich, sich direkt an eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten zu wenden. Wie man einen Termin bei ihnen bekommen kann, erfährst du hier.
Möchtest du dir ein Bild davon machen, welche Ansprechperson die richtige für dich oder eine andere betroffene Person wäre? Wir erklären dir, welche Fachleute in welcher Situation die besten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind.
Solltest du weitere Unterstützung auf dem Weg zur Therapie benötigen oder erst mal anonym mit jemandem sprechen wollen, dann findest du hier Links zu Anlaufstellen in deiner Nähe und Kontakte zu vertrauenswürdigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern.
Süchte gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, und sie beziehen sich entweder auf ein bestimmtes Mittel oder ein Verhalten. Sie alle haben gemeinsam, dass im Gehirn starke Glücks- und Belohnungsgefühle durch dieses Mittel oder Verhalten ausgelöst werden. Der sogenannte Belohnungseffekt verleitet dazu, die Sucht erneut zu befriedigen, also das Mittel erneut einzunehmen oder das Verhalten zu wiederholen. Der Wunsch nach Belohnung durch diese Sucht ist besonders dann groß, wenn es der betroffenen Person gerade nicht gut geht – zum Beispiel, wenn sie Sorgen oder Ängste hat. Viele Betroffene haben das Gefühl, die Kontrolle über die Sucht zu verlieren. Das heißt, sie können ihr Verhalten in Bezug auf ihre Sucht nicht mehr steuern, und sie wird für sie zu einer Art Zwang.
Folgende Beschwerden können auf eine Abhängigkeit hinweisen – besonders, wenn sie ständig da sind:
- ein sehr starker Wunsch danach, Alkohol, Tabletten oder andere Drogen einzunehmen – auch wenn dieses Verhalten schädlich ist
- dieser Wunsch kann sich auch auf ein bestimmtes Verhalten beziehen, wie Glücksspiel, Online-Shopping oder Computerspielen
- keine Kontrolle mehr darüber, ob und wieviel Alkohol, Tabletten oder andere Drogen eingenommen werden oder wann sie eingenommen werden
- es muss immer mehr konsumiert werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen
- körperliche Beschwerden wie Unruhe, Zittern oder Schmerzen, wenn die Sucht nicht befriedigt werden kann
- die Gedanken kreisen ständig um die Sucht und es fällt sehr schwer, sich auf etwas Anderes zu konzentrieren
- kein Interesse mehr an Dingen, die einem vorher Freude bereitet haben, wie Freundschaften oder Hobbies
- Heimlichkeiten in Bezug auf den Konsum oder das Verhalten
Der andauernde Zustand in einer Sucht hat schädliche Folgen – aber Personen, die an einer Sucht erkrankt sind, können ihr Verhalten nicht steuern, obwohl ihnen diese Folgen bewusst sind.
Was ist ein Suchtmittel?
Ein Suchtmittel ist ein Stoff, der mit hoher Wahrscheinlichkeit abhängig macht. Es gibt legale Suchtmittel wie Alkohol, Medikamente oder Zigaretten, und illegale Suchtmittel wie Cannabis, Speed, Kokain, Ecstasy oder Heroin. Suchtmittel unterscheiden sich außerdem in ihrer Wirkung und darin, wie schädlich sie sind und wie schnell sie abhängig machen.
Was sind Verhaltenssüchte?
Verhaltenssüchte beziehen sich auf ein bestimmtes Verhalten, das nicht mehr kontrolliert werden kann und so viel Raum im Leben der Betroffenen einnimmt, dass es ihnen sehr schadet. Wie bei den Suchtmitteln gibt es auch bestimmte Verhaltensweisen, die eher süchtig machen als andere. Glücksspielsucht und Internetsucht sind weit verbreitete Verhaltenssüchte, ebenso wie Kaufsucht, Sexsucht oder Arbeitssucht. Sie alle haben gemeinsam, dass das Verhalten starke Glücks- und Belohnungsgefühle im Gehirn auslöst – zum Beispiel, wenn man sich etwas Schönes gekauft hat oder am Spielautomaten Geld gewonnen hat. Das ruft bei den Betroffenen den Drang hervor, dieses Verhalten immer öfter zu wiederholen. Dass wir Dinge tun, die uns ein gutes Gefühl geben, ist grundsätzlich toll. Bei einer Verhaltenssucht wird dieses Wiederholen aber zu einer Art Zwang.
Ein paar Beispiele:
Süchte gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, und sie beziehen sich entweder auf ein bestimmtes Mittel oder ein Verhalten. Sie alle haben gemeinsam, dass im Gehirn starke Glücks- und Belohnungsgefühle durch dieses Mittel oder Verhalten ausgelöst werden. Der sogenannte Belohnungseffekt verleitet dazu, die Sucht erneut zu befriedigen, also das Mittel erneut einzunehmen oder das Verhalten zu wiederholen. Der Wunsch nach Belohnung durch diese Sucht ist besonders dann groß, wenn es der betroffenen Person gerade nicht gut geht – zum Beispiel, wenn sie Sorgen oder Ängste hat. Viele Betroffene haben das Gefühl, die Kontrolle über die Sucht zu verlieren. Das heißt, sie können ihr Verhalten in Bezug auf ihre Sucht nicht mehr steuern, und sie wird für sie zu einer Art Zwang.
Folgende Beschwerden können auf eine Abhängigkeit hinweisen – besonders, wenn sie ständig da sind:
- ein sehr starker Wunsch danach, Alkohol, Tabletten oder andere Drogen einzunehmen – auch wenn dieses Verhalten schädlich ist
- dieser Wunsch kann sich auch auf ein bestimmtes Verhalten beziehen, wie Glücksspiel, Online-Shopping oder Computerspielen
- keine Kontrolle mehr darüber, ob und wieviel Alkohol, Tabletten oder andere Drogen eingenommen werden oder wann sie eingenommen werden
- es muss immer mehr konsumiert werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen
- körperliche Beschwerden wie Unruhe, Zittern oder Schmerzen, wenn die Sucht nicht befriedigt werden kann
- die Gedanken kreisen ständig um die Sucht und es fällt sehr schwer, sich auf etwas Anderes zu konzentrieren
- kein Interesse mehr an Dingen, die einem vorher Freude bereitet haben, wie Freundschaften oder Hobbies
- Heimlichkeiten in Bezug auf den Konsum oder das Verhalten
Der andauernde Zustand in einer Sucht hat schädliche Folgen – aber Personen, die an einer Sucht erkrankt sind, können ihr Verhalten nicht steuern, obwohl ihnen diese Folgen bewusst sind.
Was ist ein Suchtmittel?
Ein Suchtmittel ist ein Stoff, der mit hoher Wahrscheinlichkeit abhängig macht. Es gibt legale Suchtmittel wie Alkohol, Medikamente oder Zigaretten, und illegale Suchtmittel wie Cannabis, Speed, Kokain, Ecstasy oder Heroin. Suchtmittel unterscheiden sich außerdem in ihrer Wirkung und darin, wie schädlich sie sind und wie schnell sie abhängig machen.
Was sind Verhaltenssüchte?
Verhaltenssüchte beziehen sich auf ein bestimmtes Verhalten, das nicht mehr kontrolliert werden kann und so viel Raum im Leben der Betroffenen einnimmt, dass es ihnen sehr schadet. Wie bei den Suchtmitteln gibt es auch bestimmte Verhaltensweisen, die eher süchtig machen als andere. Glücksspielsucht und Internetsucht sind weit verbreitete Verhaltenssüchte, ebenso wie Kaufsucht, Sexsucht oder Arbeitssucht. Sie alle haben gemeinsam, dass das Verhalten starke Glücks- und Belohnungsgefühle im Gehirn auslöst – zum Beispiel, wenn man sich etwas Schönes gekauft hat oder am Spielautomaten Geld gewonnen hat. Das ruft bei den Betroffenen den Drang hervor, dieses Verhalten immer öfter zu wiederholen. Dass wir Dinge tun, die uns ein gutes Gefühl geben, ist grundsätzlich toll. Bei einer Verhaltenssucht wird dieses Wiederholen aber zu einer Art Zwang.
Ein paar Beispiele:
Glücksspielsucht ist eine Krankheit, bei der die Betroffenen hohe Mengen an Geld verspielen – an Automaten in Spielotheken, in Online-Casinos, bei Online-Wetten oder in Wettbüros. Erst machen diese Spiele Spaß und lösen Glücksgefühle aus, aber dann wird der Weg in die Spielothek schnell zum Zwang: Betroffene werden unruhig und reizbar, wenn sie nicht spielen können. Sie spielen mit immer höheren Einsätzen, um Verluste auszugleichen, und spielen auch dann weiter, wenn sie ihr gesetztes Limit erreicht haben. Das hat sehr oft vor allem finanzielle Folgen im Leben der Betroffenen: Sie haben kein Geld mehr für Rechnungen, Reparaturen im Haushalt, für Essen, Strom oder die Miete. Oft verschulden Betroffene sich im Freundes- und Bekanntenkreis oder nehmen teure Kredite auf, um weiter spielen zu können. Gleichzeitig verlieren sie Beziehungen zu Menschen, die ihnen wichtig sind. Das kann daran liegen, dass die Betroffenen das Vertrauen der Menschen in ihrem Umfeld verlieren, oder auch daran, dass sie sich selbst aus ihrem gewohnten Umfeld zurück ziehen.
Wichtige Anzeichen für eine Spielsucht sind:
Starkes Verlangen: Bei Spielsüchtigen wird das Spielen zum wichtigsten Lebensinhalt. Das Denken und Handeln kreist immer mehr um die Fragen: „Wann kann ich wieder spielen? Ist genug Geld da, um Spielen zu können?“.
Kontrollverlust: Spielsüchtige können ihr Verhalten in Bezug auf das Spielen nicht mehr steuern. Sie spielen einfach weiter, solange es geht – auch bei großen Verlusten oder bis kein Geld mehr da ist. Das macht eine Spielsucht so gefährlich, denn daraus können hohe Verschuldungen entstehen.
Toleranzentwicklung: Bei vielen Spielsüchtigen stehen am Anfang große Gewinne, die einen großen Reiz ausüben und das Gefühl vermitteln, dass es immer so weiter geht. Das Gegenteil ist aber der Fall: Das Glück lässt schnell nach, und um verlorene Summen wieder zu bekommen, muss man weiter spielen. Das Glücksgefühl vom Anfang kommt erst dann wieder hoch, wenn höhere Summen gewonnen werden – schließlich müssen die Verluste wieder eingeholt werden.
Entzugssymptome: Wie bei anderen Süchten auch fühlen sich Spielsüchtige nervös, unruhig oder gereizt, wenn sie nicht spielen können.
Vernachlässigen von Freundschaften und Hobbies: Der Spieldruck führt dazu, dass Betroffene viel Zeit in Spielotheken oder mit dem Spielen verbringen. Auch die Geldbeschaffung, zum Beispiel durch den Verkauf von Einrichtungsgegenständen, nimmt zunehmend Zeit in Anspruch. Freundschaften und Hobbies geraten in den Hintergrund, auch, weil niemand etwas von dem schädlichen Verhalten mitbekommen soll.
Weiterspielen trotz schädlicher Folgen: Süchtige nehmen die schädlichen Folgen ihres Verhaltens oft sehr lange in Kauf. Der Drang zu spielen ist so stark, das auch hohe Verschuldungen, der Verlust von Freundschaften oder Probleme im Beruf daran nichts ändern.
Folgende Fragen können dir helfen zu erkennen, ob du bereits auf dem Weg zu einer Spielsucht bist:
- Verspielst du mehr Geld, als du eigentlich möchtest?
- Musst du auf andere wichtige Dinge – wie Essen, Kleidung oder Hobbies – verzichten, weil du dein Geld beim Spielen verlierst?
- Verschuldest du dich bei deiner Familie, Freundinnen oder Freunden, um weiter spielen zu können?
- Ist es dir unangenehm, darüber zu reden, wie viel oder wie oft du spielst?
Wenn du das Gefühl hast, von einer Spielsucht gefährdet zu sein, solltest du dir Hilfe und Unterstützung holen. Freundinnen, Freunde und die Familie können eine große Unterstützung sein, aber wenn du dich erstmal anonym austauschen oder professionelle Hilfe bekommen möchtest, gibt es viele Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat hier einige aufgelistet und bietet auch eine Telefonhotline an.
Neben Tabak- ist die Alkoholsucht die in Deutschland am weitesten verbreitete Suchterkrankung. Es gibt unterschiedliche Formen und Entwicklungsstufen der Alkoholsucht. Medizinisch wird zwischen Alkohol-Missbrauch und Alkohol-Abhängigkeit unterschieden, wobei die Übergänge fließend sind.
Von Alkoholmissbrauch spricht man dann, wenn der Alkohol bereits eine Funktion im Leben der Betroffenen übernimmt, wie sich zu entspannen oder sich zu belohnen. Wird diese Funktion für längere Zeit regelmäßig benutzt, kann es zur Abhängigkeit kommen. Dieser Prozess passiert oft unbemerkt, sodass weder die betroffene Person noch ihre Freundinnen, Freunde oder die Familie den Beginn einer Alkoholsucht bemerken. Deswegen ist es wichtig, auf sich und nahestehende Personen zu achten und erste Anzeichen ernst zu nehmen.
Wichtige Anzeichen für eine Alkoholsucht sind:
Starkes Verlangen: Sehr charakteristisch ist ein starkes Verlangen nach Alkohol. Das Verlangen wird umso stärker, je mehr die Betroffenen versuchen, nicht zu trinken. Frag dich selbst: Suchst du dir zunehmend Gelegenheiten, um Alkohol zu trinken?
Kontrollverlust: Betroffene haben keine Kontrolle mehr über ihr Trinkverhalten oder die Menge ihres Konsums. Während gesunde Menschen nach einem Glas wieder aufhören können, ist es bei Alkoholsüchtigen so, als würde ein Schalter in ihrem Kopf umgelegt werden, der dazu führt, dass sie immer weiter trinken, auch wenn sie beispielsweise am nächsten Tag früh aufstehen müssen oder einen wichtigen Termin haben.
Toleranzentwicklung: Betroffene müssen immer mehr Alkohol trinken, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das liegt daran, dass ihr Körper sich bereits an die Mengen gewöhnt hat. Menschen mit Suchterkrankung vertragen dann oft sehr viel mehr als nicht süchtige Menschen.
Entzugssymptome: Entzugssymptome wie Zittern, Schwitzen, Schlafstörungen, Angst und depressive Verstimmungen weisen bereits sehr stark auf eine Abhängigkeit hin. Sie zeigen an, dass Körper und Geist ohne den Alkohol nicht mehr richtig funktionieren, und verschwinden in der Regel, wenn wieder neuer Alkohol getrunken wird.
Vernachlässigen von Freundschaften und Hobbies: Da der Alkohol einen sehr großen Platz im Leben der Betroffenen einnimmt, rücken andere Interessen und auch Freundinnen, Freunde oder die Familie immer weiter in den Hintergrund. Auch Heimlichkeiten spielen hierbei eine große Rolle, denn viele Betroffene ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück, damit niemand merkt, wie viel oder wie oft sie trinken.
Andauernder Konsum trotz schädlicher Folgen: Wer süchtig ist, nimmt die schädlichen Folgen seines Trinkens in Kauf. Das können körperliche Beschwerden sein – wie der Kater am nächsten Tag -, aber auch das Verpassen wichtiger Termine, schlechte Leistungen bei der Arbeit oder Probleme mit Freundinnen, Freunden und in der Familie aufgrund des Alkoholkonsums. Auf lange Sicht kann eine Alkoholsucht gravierende körperliche Folgen haben, zum Beispiel Erkrankungen der Leber, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse oder der Magenschleimhaut.
Folgende Fragen können dir helfen zu erkennen, ob dein Umgang mit Alkohol bereits ungesund ist:
- Trinkst du mehr, als du dir eigentlich vorgenommen hast?
- Wirst du unruhig bei dem Gedanken, nicht trinken zu können?
- Hast du manchmal Gedächtnislücken, weil du zu viel getrunken hast?
Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortest, solltest du dir Hilfe holen und mit jemanden darüber sprechen. In frühen Stadien ist es noch einfacher, eine Suchterkrankung wieder in den Griff zu bekommen. Vertraue dich einem Familienmitglied, einer Freundin oder einem Freund an. Wenn du lieber mit jemandem sprechen möchtest, den du nicht kennst, kannst du jederzeit kostenlos und anonym die Telefonseelsorge anrufen, und auch das Deutsche Rote Kreuz nennt hier viele Kontaktmöglichkeiten für Unterstützung bei Suchterkrankungen. Wichtig ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist und dich jemandem anvertraust.
Wir leben im digitalen Zeitalter, sind ständig online, posten, streamen, liken, spielen. Bei manchen wird die digitale Welt aber zur Sucht: Sie verlieren die Kontrolle darüber, wie viel Zeit sie in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram verbringen oder wie viel Platz im Alltag die Beschäftigung mit dem Computer oder Handy einnimmt. Auch hier wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert: Wenn andere einen Post liken, teilen oder kommentieren, oder wenn wir erfolgreich in einem Computerspiel sind, schüttet unser Gehirn Glücksgefühle aus. Das weckt den Drang, das Verhalten zu wiederholen oder noch zu steigern, bis wir mehr in der digitalen als in der realen Welt leben. Problematisch wird es dann, wenn unsere Online-Aktivitäten für uns zum Ersatz für das richtige Leben werden, wenn wir wichtige Bedürfnisse – wie Anerkennung zu erfahren oder beliebt und erfolgreich zu sein – nur online ausleben oder negative Gefühle in der echten Welt dadurch verdrängen.
Wichtige Anzeichen für eine Internetsucht sind:
Ständiges Verlangen: Wer online-süchtig ist, verspürt ständig den Drang, online zu sein und seine Netzwerke auf neue Nachrichten zu prüfen. Betroffene checken ihre Apps und Messenger mehrmals stündlich und sogar dann, wenn schon klar ist, dass keine neuen Nachrichten eingegangen sind.
Kontrollverlust: Betroffene verlieren die Kontrolle darüber, wie oft und wie lange sie online sind oder am Computer spielen. Aus einer Stunde kann schnell eine Nacht werden. Sie werden unruhig bei dem Gedanken, keinen Zugang zu ihrem Handy, Computer oder sozialen Netzwerken haben.
Toleranzentwicklung: Damit die Sucht befriedigt wird, muss auch bei der Computersucht oft immer mehr konsumiert werden. Das kann bedeuten, dass die Sucht immer mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber auch, dass die Ausprägung immer stärker wird – Spiele werden wichtiger als andere Dinge, die Frustration bei nicht ausreichenden Reaktionen auf einen Post wird größer oder die Aktivitäten im Internet werden extremer.
Entzugssymptome: Auch bei Online-Sucht gibt es Entzugssymptome: Dazu gehören insbesondere Unruhe und Gereiztheit, aber auch körperliche Symptome wie Zittern oder Schwitzen.
Vernachlässigen von Freundschaften und Hobbies: Das Spielen am Computer oder die Aktivitäten in sozialen Netzwerken nehmen einen sehr großen Platz im Leben der Betroffenen ein. Interessen im echten Leben und auch Freundschaften oder Familie rücken dadurch immer weiter in den Hintergrund. Besonders bei der Computerspielsucht findet ein Rückzug aus dem sozialen Leben statt. Das Tückische an sozialen Netzwerken ist, dass diese immer und überall genutzt werden können, also auch im Beisein von Freundinnen und Freunden.
Aufrechterhalten des Verhaltens trotz schädlicher Folgen: Betroffene merken oft selbst, dass ihre Computersucht negative Folgen auf ihr normales Leben hat, kommen aber trotzdem nicht von selbst aus ihrer Sucht heraus. Vielleicht haben sie auch schon Freundinnen oder Freunde verärgert und wurden von ihnen darauf hingewiesen, dass sie zu viel am Handy oder vor dem Computer hängen. Wie bei anderen Suchterkrankungen auch ist es aber meistens nicht möglich, ohne professionelle Hilfe und die Unterstützung von der Familie oder Freundinnen und Freunden die Sucht in den Griff zu bekommen.
Wenn du dir Sorgen um dein online-Verhalten oder das einer nahestehenden Person machst, kannst du dich an eine der vielen Hilfsangebote wenden – auch anonym, wenn dir das lieber ist. Ob du erstmal mit einer Freundin, einem Freund, oder einem Familienmitglied darüber sprechen möchtest, dein online-Verhalten besser verstehen, oder erstmal selbst versuchen möchtest, weniger online zu sein: Die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung hat hier viele Tipps dafür zusammengestellt, zeigt Anlaufstellen in deiner Nähe und bietet selbst eine Beratung an.
Auch, wenn sich eine Internetsucht vielleicht nicht wie eine „echte“ Sucht anfühlt, hat sie sehr großen Einfluss auf das Leben einer betroffenen Person und auf ihren Freundes- und Familienkreis. Beobachte deswegen deine eigene online-Nutzung und die deiner Freundinnen und Freunde, und zögere nicht, darüber zu sprechen oder Unterstützung zu suchen, wenn dir etwas Sorgen bereitet.
Sucht ist eine Erkrankung im Gehirn, bei der psychische, soziale und biologische Einflüsse zusammenspielen. Oft gibt es Probleme im Leben der Betroffenen, sie kriegen zum Beispiel wenig Halt von der Familie, haben große Sorgen und Ängste um die Zukunft oder müssen den Verlust von geliebten Menschen verarbeiten. Andere psychische Erkrankungen wie Depressionen, eine Borderline-Erkrankung oder Zwangsstörungen können eine Suchterkrankung zusätzlich fördern. Gene und Vererbung spielen ebenfalls eine Rolle: Die Kinder suchtkranker Eltern sind anfälliger dafür, ebenfalls eine Suchterkrankung zu bekommen.
Wie bei jeder psychischen Erkrankung können Betroffene einer Suchterkrankung nichts dafür, dass sie erkrankt sind. Viele Menschen sind der Meinung, dass Menschen mit Suchterkrankungen keine Disziplin hätten oder selbst Schuld an ihrer Erkrankung seien – das stimmt aber nicht! Jede und jeder von uns kann eine Sucht entwickeln, und deswegen ist es wichtig, dass wir anfangen, offen darüber zu sprechen, wenn es uns nicht gut geht, und dass wir aufmerksam und respektvoll auf die Menschen in unserem Umfeld zugehen, um die wir uns Sorgen machen.
Suchterkrankungen sind sehr vielfältig und entstehen individuell. Warum es zum Beginn einer Suchterkrankung kommt, ist also von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Suchterkrankungen basieren aber auf dem gleichen Prozess: Das Gehirn lernt, dass das Suchtmittel oder das Verhalten gut tut, bis sich Betroffene ohne diese nicht mehr gut fühlen können. Es entsteht eine Art Zwang, die Sucht aufrechtzuerhalten.
Die Befriedigung der Sucht löst in der Regel positive Gefühle wie Entspannung, Freude und Ausgelassenheit aus – die Betroffenen fühlen sich gut und stark, alle Probleme verfliegen für eine Weile. Der Körper merkt sich dieses Gefühl und bringt es in einen Zusammenhang mit dem Suchtmittel oder dem süchtig machenden Verhalten. Wenn die Wirkung nachlässt, sind die alten Probleme wieder da. Geht es den Betroffenen schlecht, taucht automatisch der Gedanke an die „befreiende“ Wirkung der Sucht auf. Es fällt ihnen schwer, diesen Gedanken zu ignorieren oder etwas anderes zu finden, was ihnen aus der schlechten Situation helfen kann. Es ist wie ein Zwang für sie, die Sucht zu befriedigen – also zum Beispiel weiter zu trinken oder zu spielen –, weil sie sich nur dadurch wieder gut fühlen können. Das ist der Grund, warum Menschen mit Suchterkrankungen auch dann noch trinken oder spielen, wenn das bereits schlimme Folgen für sie hat. Der Gedanke an ein Leben ohne das Suchtmittel oder das süchtig machende Verhalten macht vielen Betroffenen zunächst Angst. Auch wenn sie selbst den Wunsch haben, nicht mehr süchtig zu sein, ist es sehr schwierig für sie, die ersten Schritte auf diesem Weg zu gehen.
Das Wichtigste ist: Sei ehrlich zu dir selbst. Hast du selbst die Vermutung, dass du die Kontrolle verlierst, du zu viel trinkst, spielst, kiffst oder ähnliches? Oder beobachtest du dieses Verhalten bei einer Freundin, einem Freund oder einem Familienmitglied? Dann sprich mit jemandem darüber! Es gibt viele Anlaufstellen, bei denen professionell ausgebildete Personen dir zuhören und helfen. Die Angebote sind kostenlos und du kannst anonym bleiben. Außerdem bieten viele Kliniken einen Suchtnotruf an, bei dem man jederzeit anrufen kann.
In größeren Städten gibt es auch spezielle Suchtberatungsstellen. Sie bieten viele Informationen zum Hilfsangebot in deiner Stadt, helfen dir dabei, Anträge zu stellen, die richtige Klinik zu finden oder hören erstmal einfach nur zu und beraten dich.
Das Suchthilfe-Netzwerk in Deutschland ist sehr gut ausgebaut und bietet viele Hilfsmöglichkeiten für Betroffene. Grundsätzlich empfiehlt sich der Schritt in eine Therapie. Diese kann ambulant, teilstationär oder stationär erfolgen. Wenn du mehr über das Thema Therapie erfahren möchtest, haben wir hier alles wichtige für dich zusammengefasst.
Suchterkrankungen sind alleine schwer zu bewältigen. Deshalb ist es wichtig, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und über die eigenen Probleme und Erfahrungen zu sprechen. Selbsthilfegruppen bieten dabei eine große Unterstützung, denn hier finden Betroffene Verständnis für ihre Situation und können durch die Erfahrungen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, mit der Suchterkrankung umzugehen. Auch für Angehörige von Menschen, die eine Suchterkrankung haben, gibt es Selbsthilfegruppen.
Du hast dich entschlossen, für dich selbst oder einen nahestehenden Menschen Hilfe zu suchen und fragst dich, wo du Unterstützung finden kannst. Vorab: Du solltest wissen, dass es viele unterschiedliche Anlaufstellen gibt und verschiedene Fachleute in Frage kommen. Wichtig ist es also, zuerst herauszufinden, welcher Weg der passende ist.
Eine gute erste Ansprechperson ist deswegen immer die Hausärztin oder der Hausarzt. Übrigens ist bei denen alles, was mit ihnen besprochen wird, gut aufgehoben: Sie dürfen und werden wegen der ärztlichen Schweigepflicht mit niemandem darüber reden, was man ihnen erzählt. Natürlich kann ein Familienmitglied, eine Freundin oder ein Freund mit zum Gespräch kommen.
Es ist auch möglich, sich direkt an eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten zu wenden. Wie man einen Termin bei ihnen bekommen kann, erfährst du hier.
Möchtest du dir ein Bild davon machen, welche Ansprechperson die richtige für dich oder eine andere betroffene Person wäre? Wir erklären dir, welche Fachleute in welcher Situation die besten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind.
Solltest du weitere Unterstützung auf dem Weg zur Therapie benötigen oder erst mal anonym mit jemandem sprechen wollen, dann findest du hier Links zu Anlaufstellen in deiner Nähe und Kontakte zu vertrauenswürdigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern.